« Homöopathische Arzneimittelprüfung aus wissenschaftlicher Sicht. Vorträge von Dr. med. Michael Teut und Dipl.-Stat. Rainer Lüdtke. (→ Organon 2010-Veranstaltung) | Home | Homöopathie und SPIEGEL (-fechterei) »
Wie chronisch Kranke zu kompetenten Managern ihrer Erkrankung werden: Interview mit Dr. phil. Bettina Berger. (? Patientenkompetenz, Patientenschulung)
Von Claus Fritzsche | 8.November 2010
Jede Zeit hat ihre eigenen Volkskrankheiten. Prägte noch vor 100 Jahren die Angst vor Seuchen, Epidemien, Bakterien und Viren unser Gesundheitssystem, so beschäftigen uns heute chronische Krankheiten. Ob Hypertonie, Herzkrankheiten, Diabetes Mellitus, Arthritiden, Asthma Bronchiale oder Depression, etwa 40% aller Bundesbürger gelten als chronisch Krank. Behandeln Ärzte und Ärztinnen chronische Krankheiten effektiv? „Oftmals nicht effektiv genug“, sagt Dr. Bettina Berger, Studienkoordinatorin am Lehrstuhl für Medizintheorie und Komplementärmedizin der Universität Witten/Herdecke und Expertin für Versorgungsforschung, Qualitative Forschung und Patientenkompetenz. Die wachsende Nachfrage nach komplementärmedizinischen Verfahren ist auch ein Ausdruck der Unzufriedenheit der Patienten mit ihrer Behandlung im herkömmlichen Setting. Was ihnen nachhaltig helfen konnte, das schildert Dr. Bettina Berger im folgenden Interview.

Frau Dr. Berger, chronische Krankheiten sind „das Volksleiden“ unserer Zeit. Sie verursachen sehr hohe Kosten und beeinträchtigen die Lebensqualität vieler Menschen. Geht unser Gesundheitssystem mit chronischen Leiden effektiv genug um?
Dr. Bettina Berger: Diese Frage ist etwas zu umfassend, als das ich alleine sie angemessen beantworten könnte. Das Gesundheitswesen hat noch nicht an allen Stellen verstanden, dass wir es zunehmend mit chronischen Patienten zu tun haben, und dass wir zur Behandlung von chronischen Patienten und Patientinnen ein anderes Konzept von Patienten und ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten benötigen als für die akuten Patienten. Noch viel zu häufig stoßen Patienten und Patientinnen auf Ärzte oder Ärztinnen, die nicht ausreichend Respekt und Wertschätzung für die von Patienten mit chronischen Erkrankungen geleistete oder zu leistende Krankheitsarbeit entgegen bringen. Die hohe Inanspruchnahme und Nachfrage nach komplementärmedizinischen Verfahren ist ja unter anderem dadurch zu erklären, dass Patienten und Patientinnen insbesondere als chronische Patienten mit dem konventionellen Setting häufig unzufrieden sind und von Bevormundungen, moralischen Appellen, Einschüchterungen bzw. Verängstigung berichten.
Sie beschäftigen sich als Forscherin mit Fragen der Kompetenzsteigerung von Patienten. Was ist damit gemeint?
Dr. Bettina Berger: Eigentlich ist es ja fast ein Widerspruch von Kompetenz auf der einen und Patienten auf der anderen Seite zu sprechen. Ethymologisch drückt das Wort Kompetenz aus, dass einem Menschen eine bestimmte Verantwortung und Fähigkeit zum Handeln zugesprochen wird, das Wort Patient aber steht für den geduldig und passiv Leidenden, der es dem Fachpersonal überlässt, zu entscheiden, was gut für ihn ist. Dieses Bild ändert sich zwar langsam, aber wir haben noch lange nicht für alle Erkrankungen die dafür notwendigen unterstützenden Strukturen. Denn wenn Menschen an einer chronischen Erkrankung leiden, benötigen sie ausreichend gründliche Schulungen, um die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen, die sie benötigen, um ihre Erkrankung möglichst eigenständig managen zu können. Und wenn man vom komplementärmedizinischen Standpunkt aus argumentiert, dass es auch darum gehen kann, Selbstheilungskräfte zu aktivieren, so gelingt dies eher, wenn dafür Lern-, Übungs- oder Reflexionsphasen genutzt werden können.
Welche Vorteile hat es, wenn das Management chronischer Erkrankungen vom Arzt hin zum Patienten verlagert wird?
Dr. Bettina Berger: Der Arzt sieht den Patienten oder die Patientin vielleicht alle drei Monate einmal. Patienten müssen aber mit ihrer Erkrankung jeden Tag leben und mit dieser Erkrankung umgehen. Sie können gar nicht immer warten, bis sie sich wieder mit einem Arzt darüber konsultieren können, wie sie nun den Blutzucker einstellen oder die Medikamentendosis ändern. Das bedeutet, es geht sowohl um die Lebensqualität der Patienten als auch um die harten klinischen Erfolge einer Behandlung. Beides wird besser, wenn Patienten und Patientinnen die Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen, eigenständig zu handeln.
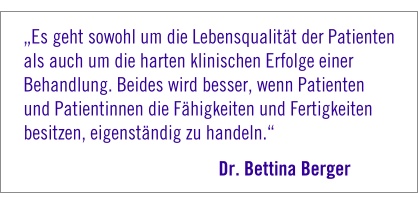
Außerdem haben Patienten einen anderen Schwerpunkt als Ärzte. Ärzte und das medizinische Personal fokussieren – verständlicher Weise – auf medizinische Parameter. Sie wollen gute physiologische Messwerte erreichen. Patienten wollen aber auch noch eine gute Lebensqualität haben. Sie müssen beide Zielsetzungen unter einen Hut bringen. Das kann unter Umständen für eine gewisse Zeit auch auf Kosten der guten Blutzucker- oder Blutdruckeinstellung gehen. Aber vielleicht ist ja ein bestimmter vom medizinischen System vorgegeben Messwert auch gar nicht so korrekt, wie die Ärzte immer vorgeben. Bei Typ-2-Diabetikern wurde gerade eine Studie abgebrochen, weil sie gezeigt hat, dass eine zu engmaschige und strenge Kontrolle der Blutzuckerwerte zu einer Steigerung der Mortalität führt. Das bedeutet, Patienten tun hin und wieder gut daran, ihren eigenen Bedürfnissen zu trauen und diese bei dem Management ihrer Erkrankung zu berücksichtigen. Vorgegebene Zielparameter sollten ruhig kritisch hinterfragt werden.
Typ-1-Diabetiker haben zum Beispiel irgendwann angefangen, sich ihre täglich vier- bis sechsfachen Insulininjektionen durch die Kleidungsstücke zu geben. Das war eine Entscheidung aus Gründen der Lebensqualität. Irgendwann hat man keine Lust mehr, wegen jeder Injektion ein spannendes Gespräch zu unterbrechen. Man gibt sich die Insulininjektion nebenbei unter dem Tisch, ohne dass es jemandem auffällt. Erst haben die Ärzte geschimpft, dann haben die Patienten eingefordert, doch mal eine Studie zu dieser Frage durchzuführen. Und siehe da, es hat sich herausgestellt, dass es keine zusätzlichen Infektionen oder Hautschädigungen durch die Injektionen durch die Bekleidung gibt.
Gibt es konkrete Beispiele, in denen Patienten ihre chronische Erkrankung bereits mit Erfolg „selbst managen“?
Dr. Bettina Berger: Ja, natürlich, schauen Sie sich auf den Seiten der Rentenversicherung an, für welche Patientenschulungen strukturierte Schulungsprogramme registriert worden sind (Anmerkung der Redaktion: siehe hierzu auch der folgende Ergebnisbericht „Recherche und Bewertung von Schulungsprogrammen“ des Instituts für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen GmbH). Allen voran Schulungsprogramm für Patienten mit Diabetes mellitus, egal ob insulinabhängige Typ-I- oder Typ-II Diabetiker oder auch Typ-II-Diabetiker, die sich auf Diät oder Medikamente haben einstellen lassen, aber auch z. B. für Patienten mit Asthma, COPD, koronaren Herzerkrankungen und einigen psychiatrischen Indikationen.
Aber es gibt zahlreiche Erkrankungen wie Epilepsie, Bipolare Störungen, Multiple Sklerosis und viel andere mehr, wo es derartige Interventionen nicht gibt. Diese Schulungsprogramme müssen bestimmten Kriterien in der Entwicklung und Evaluationen gerecht werden, die dort auf den Seiten einsichtig sind, damit sie von den Kassen auch finanziert und erstattet werden.
Wie können Patienten mit chronischen Krankheiten befähigt werden, selbst einen größeren Beitrag für ihre eigene Gesundheit zu leisten? Welche Werkzeuge zur Steigerung von Patientenkompetenz gibt es?
Dr. Bettina Berger: Wie schon gesagt, ein Instrument sind strukturierte Schulungsprogramme. Hier erhalten Patienten und Patientinnen das Wissen zur Verfügung gestellt, das sie benötigen, um eine eigenständige, informierte Entscheidung darüber treffen zu können, welche der möglichen Handlungsoptionen für sie die angemessene ist. Im Rahmen solcher Schulungsprogramme können sie sich die dafür notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen.
Das kann zum Beispiel bedeuten, für den eigenen Körper auszutesten, wie hoch die Dosis eines Medikamentes sein muss unter normalen Bedingungen, aber auch unter anderen Umständen wie Sport oder Erkrankungen, bei einer Party oder im Urlaub. Solche Schulungsprogramme dauern in der Regel bis zu einer Woche oder auch länger.
Aber auch Entscheidungshilfen sind ein gutes Instrument, um Patienten zu befähigen, eigenständige Entscheidungen zu treffen und schon vor der Entscheidung – zum Beispiel für oder gegen eine operative Maßnahme – die Auswirkung der jeweiligen Entscheidung mit berücksichtigen zu können.
Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen darüber, ob Maßnahmen zur Steigerung der Patientenkompetenz auf Seiten der Patienten bestimmte Voraussetzungen erfordern – z. B. Bildung und Motivation – die nicht zwangsläufig in allen Bevölkerungsgruppen gleichmäßig gegeben sind?
Dr. Bettina Berger: Ein Strang der Diskussion um Patientenkompetenz stammt aus den USA. Hier wird unter dem gerade sehr in Mode gekommenen Konzept der Health Literacy darüber nachgedacht, dass man ja Patienten ausreichend Lesen und Rechnen beibringen muss, damit sie auch die Packungsbeilagen lesen und sich an die Anweisungen des Arztes halten. Dieses Konzept der Patientenkompetenz ist ursprünglich sehr auf Compliance konzentriert.
Deshalb wurde das Konzept auch unter anderem durch Ilona Kickbusch und viele andere Leute auf andere Dimensionen erweitert, wie zum Beispiel auch die Kompetenz, kritisch Informationen beurteilen zu können. An der Fachwissenschaft Gesundheit der Universität Hamburg wurden unter Leitung von Prof. Dr. Ingrid Mühlhauser zahlreiche Schulungsprogramme, Patienteninformationen und Entscheidungshilfen entwickelt, die Patienten und Patientinnen befähigen sollen, eigenständig über die zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen zu entscheiden.
Es gibt zahlreiche Studien, die aussagen, dass – je nach Land und Altersgruppe – ca. zwei Drittel der Patienten und Patientinnen, selbst wenn sie älter werden, in die Entscheidungen über ihre Behandlungen mit einbezogen werden wollen. Das kann sich natürlich ändern, auch im eigenen Lebenslauf. Einmal ist es mir wichtiger, selber entscheiden zu können und in einer anderen Situation möchte ich die Entscheidung vielleicht lieber gemeinsame mit dem Arzt treffen oder sie auch ganz diesem überlassen. Diese Bedürfnisse bezüglich der Einbeziehung in die Entscheidungsfindung müssen eben mit erhoben werden.
Die Steigerung der Selbstmanagement-Kompetenz von chronisch kranken Menschen ist im Bereich der modernen Medizin ein noch junger Trend, scheint im Bereich der komplementärmedizinischen Therapieverfahren jedoch komplett unbekannt zu sein. Warum?
Dr. Bettina Berger: Es kommt darauf an, welches Menschenbild hinter der Verwendung eines komplementären Verfahrens steckt. Möchte ich die Eigenkompetenz des Patienten stärken, werde ich danach suchen, ob es Schulungsprogramme oder andere Möglichkeiten gibt, die Patienten und Patientinnen dabei unterstützen. Übende Verfahren werden in diesem Zusammenhang immer wichtiger, sei es Yoga, Eurhythmie, Qi Gong oder Achtsamkeitsschulungen. In der Klinik für Naturheilverfahren in Essen unter der Leitung von Prof. Dr. Dobos werden derartige strukturierte Schulungsprogramme unter Einschluss komplementärmedizinischer Verfahren bereits angeboten. Hier handelt es sich um verschiedene Body-Mind-Verfahren.
Andere komplementärmedizinische Verfahren sind im klassischen Sinne paternalistisch und setzen ausschließlich auf die Fachkenntnisse des Therapeuten oder der Therapeutin. Solange der therapeutische Ansatz die Anregung zu Selbstheilung ist, geht diese Expertise damit einher, dem Patienten Kompetenzen zum Selbstmanagement zu vermitteln. Aber das ist nicht unbedingt und überall so. In der Traditionellen chinesischen Medizin ist es zum Beispiel überhaupt nicht üblich, dass die Patienten verstehen, warum welche Punkt akupunktiert wird.
Trotzdem scheint beispielsweise eine homöopathische Behandlung sowie die Interaktion mit einem Homöopathen von vielen Menschen als Steigerung der Selbstmanagement-Kompetenz empfunden zu werden. Haben Sie eine Erklärung für dieses Phänomen?
Dr. Bettina Berger: Ja, die Behandlung bei einem Homöopathen erleben Patienten und Patientinnen als Steigerung ihrer eigenen Kompetenz, weil ihnen zuerkannt und zugemutet wird, sich selber zu beobachten und ihre Wahrnehmungen mit in den Behandlungsprozess einzubringen. Auch werden sie häufig durchaus ermuntert, Bagatellerkrankungen eigenständig zu therapieren. Das homöopathische Konzept wird häufig als auch für Laien nachvollziehbar und vermittelbar kommuniziert. Ähnliches gilt für die Kunsttherapie im Rahmen der anthroposophischen Medizin: die Behandlung lädt zu einer eigenständigen Auseinandersetzung mit der Bedeutung bestimmter gesundheitlicher Fragestellungen ein und hilft Patienten somit, ihre Eigenkompetenz zu stärken.
„Shared Decision Making“ (SDM) ist ein weiterer noch junger Trend der modernen Medizin. Gibt es SDM-Entscheidungshilfen auch für komplementärmedizinische Therapieverfahren?
Dr. Bettina Berger: Im deutschen Sprachraum sprechen wir von Partizipativer Entscheidungsfindung. Dieser Begriff generiert sich als ein Dachkonzept für alle möglichen Vorstellungen einer gemeinsamen Entscheidungsfindung zwischen Ärzten und Patienten.
Entscheidungshilfen sind hier zusätzliche Instrumente, die es Patienten und Patientinnen auch außerhalb der Arzt-Patienteninteraktion erlauben, sich mit einer gesundheitsrelevanten Fragestellung strukturiert auseinander zu setzen und sich die für eine gesundheitliche Entscheidung zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen vor Augen zu führen. Darüber hinaus sollen die Vor- und Nachteile der jeweiligen Handlungsoptionen vorgestellt werden.
Das interessanteste an dem Phänomen der Entscheidungshilfe ist aber, dass es hier systematisch darum geht, die subjektiven Dimensionen von Patienten mit in den Entscheidungsprozess einzubeziehen, sei es die Angst vor Nebenwirkungen oder das Wissen um die eigene Trägheit bei der Durchführung eines Übungsprogramms oder die Bedürfnisse nach komplementärmedizinischen Verfahren.
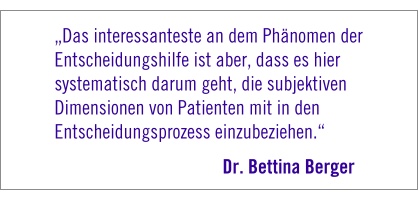
Das ist bislang in der systematischen Art und Weise bei uns nach wie vor weitestgehend unbekannt. Aber ich halte diese Instrumente zum Beispiel für anthroposophische Kliniken für eine spannende Intervention, weil es hier um die Steigerung der individuellen Erkenntnis- und Entwicklungsmöglichkeiten geht. Soweit ich die Szene überschaue, konnte ich bislang aber noch kaum Entscheidungshilfen zur Kenntnis nehmen, die komplementärmedizinische Behandlungsoptionen beinhalten.
Woran könnte dies liegen?
Dr. Bettina Berger: Dafür kann man verschiedene Gründe geltend machen. Zum einen gehen ja viele komplementärmedizinische Verfahren davon aus, nicht ein Symptom sondern den ganzen Menschen behandeln zu wollen. Deshalb wäre die Darstellung einer komplementärmedizinischen Behandlungsalternative bei einer konkreten Erkrankung nicht so ohne weiteres möglich, ohne das gesamte Konzept der jeweiligen komplementärmedizinischen Richtung vorzustellen. Außerdem gibt es nur für begrenzt viele Erkrankungen ausreichend wissenschaftliche Evidenz, um eine Entscheidungshilfe wirklich auf der Grundlage wissenschaftlicher Studien darstellen zu können.
Was spricht für patientenorientierte Entscheidungshilfen im Bereich der Komplementärmedizin?
Dr. Bettina Berger: Das Bedürfnis zahlreicher Patienten und Patientinnen nach komplementärmedizinischen Verfahren und das zunehmende Bemühen, die hierfür notwendigen wissenschaftlichen Studien zu erstellen und bereit zu halten.
Wie groß ist die Akzeptanz entsprechender Programme unter Ärzten?
Dr. Bettina Berger: Das kann ich so pauschal nicht beantworten. Viele Ärzte arbeiten selbstverständlich mit diesen Interventionen. Andere haben ein abschätziges Bild von derartigen Hilfsmitteln, die ihnen einen Teil ihrer Arbeit abnehmen könnten. Sie meinen, den Patienten viel besser vermitteln zu können, worauf es ankommt. Das stimmt aber in der Regel so nicht. Patienten, die 10, 20 oder 30 Jahre an einer chronischen Erkrankung leiden, wissen häufig mehr als ihre behandelnden Ärzte über diese Erkrankung. Und sie haben vor allem ihrem Alter entsprechend sehr spezifische Fragestellungen, die ihnen die Ärzte auch nicht beantworten können, bei deren Lösung aber andere Patienten mit ähnlichen Erfahrungen oder auch eine Psychologin hilfreich sein kann.
Uns fehlt hier ein stärkeres Bewusstsein für die Relevanz von Schulungsprogrammen. Die Powerpointpräsentation eines Arztes, der frisch von der Universität kommt, ist kein Schulungsprogramm. Schulungsprogramme sind komplexe Interventionen, die in multidisziplinären Teams entwickelt und wissenschaftliche evaluiert werden müssen. Sie vermitteln den Teilnehmenden wissenschaftliche überprüfte Inhalte und unterstützen die TeilnehmerInnen darin, die eigenen subjektiven Fragen und Probleme bei der Bewältigung einer Erkrankung zu formulieren und zu lösen und sich dazu die entsprechende Unterstützung der medizinischen Fachkräfte holen zu können. Sie vermitteln Fähigkeiten und Fertigkeiten und nicht nur Wissen.
Die strukturierten Schulungsprogramme für Typ-1- und Typ-2-Diabetiker zum Beispiel unterrichten, wie ein Diabetiker seine Blutzuckerwerte eigenständig managen kann, wie er Sport treibt oder Eiscreme isst und dennoch gute Blutzuckerwerte hat. Das kann eine geschulte Diabetesberaterin unter Umständen wesentlich besser leisten als ein Facharzt. Ärzte haben vor der Komplexität derartiger Interventionen und
den Anforderungen an die Qualifikationen der dafür geeigneten Berufsgruppen nicht immer den nötigen Respekt.
Gute Schulungsprogramme laden Ärzte ein, schon während des Medizinstudiums bei derartigen Schulungsprogrammen zu hospitieren, um eine Ahnung von der Relevanz derartiger Programme zu erhalten.
Frau Dr. Berger, vielen Dank für dieses Gespräch.
Das Interview führte Claus Fritzsche.
.
Zur Person:
2010
Uni Witten/Herdecke: Dr. phil. Bettina Berger an der Fakultät für Gesundheit (Department für Medizin) Lehrstuhlfür Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin Private Universität Witten/Herdecke
2009
idw: Experten fordern Raum für Eigensinn: Tagung zur Patientenkompetenz an der Europauniversität Viadrina
Eine gemeinsame Expertentagung des Instituts für Transkulturelle Gesundheitswissenschaften (IntraG) und der Karl und Veronica Carstens-Stiftung thematisiert Patientenkompetenz zwischen evidenzbasierter Medizin und Komplementärmedizin. Fazit: Eigensinn und Eigeninitiative der Patienten sollten stärker gefördert werden.
.
.
Frühere Veröffentlichungen von Dr. phil. Bettina Berger in begutachteten wissenschaftlichen Fachzeitschriften:
.
2010
Berger B, Steckelberg A, Meyer G, Kasper J, Mühlhauser I: Training of patient and consumer representatives in the basic competencies of evidence-based medicine: a feasibility study
BMC Medical Education 2010, 10:16 – Appendix 1, Appendix 2
2008
2006
2005
.
.
Buchpublikationen von Bettina Berger:
.
2006
2003
.
Aktuelle Nachrichten zum Thema:
.
.
Themen: DZVhÄ Homöopathie.Blog | 4 Kommentare »

8th.November 2010 um 10:27
[…] NEU im DZVhÄ Homöopathie.Blog: Wie chronisch Kranke zu kompetenten Managern ihrer Erkrankung werden: Interview mit Dr. phil. Bettin… […]
8th.November 2010 um 14:24
[…] Wie chronisch Kranke zu kompetenten Managern ihrer Erkrankung werden: Interview mit Dr. phil. Bettina Berger … […]
26th.November 2010 um 08:19
[…] Wie chronisch Kranke zu kompetenten Managern ihrer Erkrankung werden: Interview mit Dr. phil. Bettin… | […]
6th.Dezember 2010 um 08:59
[…] die Komplementärmedizin ebenso von der modernen Medizin lernen kann, erläuterte Dr. Bettina Berger kürzlich in einem Interview. Im Umgang mit chronischen Erkrankungen denkt die Schulmedizin derzeit um und forciert […]